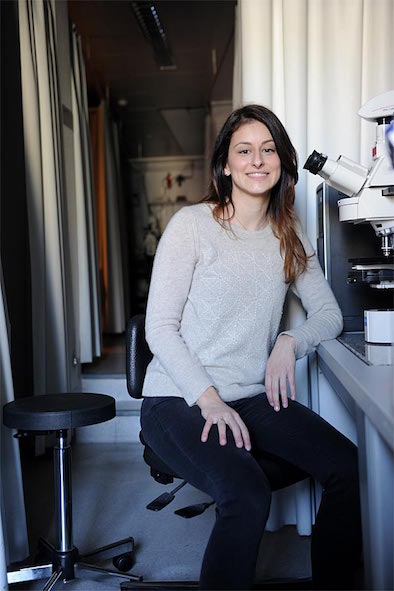Interview with the Austrian Newspaper Standard.
(foto credit: standard/corn)
INTERVIEW ROBERT CZEPEL 4. April 2016,
Bei Krebserkrankungen sind im Körper verteilte Metastasen oftmals ein Todesurteil. Anna Obenauf versucht, anpassungsfähige Krebszellen dennoch zu besiegen
STANDARD: Stimmt es, dass Krebspatienten meist gar nicht an den Tumoren sterben, sondern an den Metastasen?
Obenauf: Ja, das ist in über 90 Prozent aller Fälle so. Die Primärtumoren kann man in der Regel operativ entfernen, aber die Metastasen nur sehr schwer: Die Metastasen befinden sich oft im Gehirn, in der Lunge und in anderen Organen. Letztlich ist meist die Streuung der Tumorzellen für den Tod verantwortlich.
STANDARD: Heißt das im Umkehrschluss: Könnte man die Metastasierung verhindern, wäre Krebs zwar unangenehm, aber keine tödliche Krankheit?
Obenauf: Das ist der Punkt – und daher sind auch Vorsorgeuntersuchungen so wichtig. Wenn man Tumoren im Frühstadium erkennt, kann man sie in vielen Fällen gut behandeln und die Patienten heilen – wie zum Beispiel bei Haut-, Darm- oder Brustkrebs. Das Problem ist aber, dass Tumoren oft erst dann entdeckt werden, wenn die Tumorzellen bereits gestreut haben. Diese Tumorzellen können wir zwar nicht sehen, sie sind aber da: in einem Ruhezustand in anderen Organen. Dort warten sie auf den richtigen Zeitpunkt, um auszuwachsen.
STANDARD: Warum kann man Metastasen so schwer bekämpfen?
Obenauf: Weil sie so zahlreich und diffus im Körper verteilt sind. Und weil sie oft aggressiv sind.
STANDARD: “Aggressiv” bedeutet in diesem Fall? Obenauf: Metastasen wachsen oftmals sehr schnell, dringen in lebenswichtige Organe ein und zerstören diese. Wir haben zwar Therapien, die recht gut funktionieren – nicht zuletzt gibt es bei bestimmten Krebsarten nun auch Erfolge bei der Bekämpfung von Metastasen durch Immuntherapien. Aber wir müssen noch besser werden.
STANDARD: Besser wäre es freilich, wenn man den Tumor gleich daran hindern könnte, seine Zellen zu streuen.
Obenauf: Genau! Aber um die Streuung der Tumorzellen verhindern zu können, müssen wir den Tumor früher erkennen – und natürlich die zugrunde liegenden Mechanismen besser verstehen.
STANDARD: Gibt es keine Früherkennungstests – etwa über das Blut?
Obenauf: Doch, erste Tests gibt es schon. Sie sind jedoch noch zu ungenau und werden momentan meist nur zur Überwachung von Therapien eingesetzt. Es gibt aber noch einen anderen guten Angriffspunkt: Wenn man einen Tumor im Körper entdeckt hat, kann man durch sogenannte adjuvante Therapien die schlafenden Metastasen ausschalten. Hier ist in der Forschung momentan einiges in Bewegung.
STANDARD: Wo setzen Sie mit Ihrer Forschung in diesem Netzwerk an?
Obenauf: Ich versuche, folgende Dinge zu verstehen: Wie wandern Tumorzellen in lebenswichtige Organe ein? Wie erwachen sie aus ihrem Ruhezustand und beginnen zu wachsen? Und wie entwickeln sie Resistenzen gegen Therapien?
STANDARD: Haben Sie in Ihrer Arbeit eine Achillesferse der Metastasen ausgemacht?
Obenauf: Mit zielgerichteten Krebstherapien erreichen wir zwar beeindruckende kurzzeitige Erfolge, aber langfristig sind diese Therapien oft nicht erfolgreich.
STANDARD: Warum?
Obenauf: Wir haben entdeckt, dass sich Metastasen gegen Krebsmedikamente schützen, indem sie Wachstumsfaktoren ausschütten. Über diese werden resistente Tumorzellen zum Wachsen angeregt. Wir haben eine Kombinationstherapie für Haut- und Lungenkrebs gefunden, die diesen Vorgang im Tiermodell verhindert. Sie wird momentan in klinischen Studien getestet. Noch effektiver wäre es, zwei Therapien zu verbinden, die auf unterschiedliche Schwachstellen im Tumor abzielen: zum Beispiel eine immunstimulierende Therapie mit einer, die das Zellwachstum hemmt. Diese Hypothese testen wir derzeit in meinem Labor.
STANDARD: Die Metastasen haben mehrere Angriffspunkte – aber sie sind nur dann verwundbar, wenn man alle gleichzeitig trifft?
Obenauf: So könnte man es ausdrücken. Die meisten Tumorzellen, die vom Primärtumor in das Blut gelangen, sterben ab. Tumorzellen, die in der Lage waren, eine Metastase zu bilden, sind in der Regel extrem anpassungsfähig. Daher entwickeln diese Zellen oft auch Resistenzen gegen einzelne Therapien.
STANDARD: Was ist aus genetischer Sicht der Unterschied zwischen einer gesunden Zelle und einer Krebszelle?
Obenauf: Normale Zellen sammeln im Laufe ihres Lebens viele Mutationen an. Der Unterschied zur Krebszelle ist: Hier führen die Mutationen zu unkontrolliertem Wachstum.
STANDARD: Kann man das quantifizieren?
Obenauf: Bei jeder Zellteilung entstehen ungefähr drei Mutationen, das variiert natürlich je nach Zelltyp. Normale Zellen können also durchaus hunderte Mutationen in ihrem Erbgut haben. Bei Krebszellen können es deutlich mehr sein, vermutlich 1000 bis 20.000. Aber es reichen wahrscheinlich drei bis zehn Mutationen in Krebsgenen aus, um aus einer gesunden Zelle eine Tumorzelle zu machen.
STANDARD: Sie haben Ihren Postdoc am renommierten Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York gemacht. Wie gelang Ihnen der Sprung in die Oberliga der Krebsforschung?
Obenauf: Ich bekam damals ein Erwin-Schrödinger-Stipendium vom Wissenschaftsfonds FWF. Und mein Partner, der auch in der medizinischen Forschung tätig ist, bekam zur gleichen Zeit ein Max-Kade-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mit diesen beiden Stipendien haben wir uns an den besten Forschungsinstituten beworben. Am Memorial Sloan Kettering Cancer Center hat es zum Glück für uns beide geklappt.
STANDARD: War es für Sie Bedingung, gemeinsam dorthin gehen zu können?
Obenauf: Als Paar Wissenschaft zu machen ist sehr schwierig. Als Postdoc ist man zunächst von den Gruppenleitern abhängig – der Chef meines Partners entschied sich wenige Monate vor unserer Abreise, von San Francisco nach New York zu gehen. So kam es, dass wir überhaupt dort gelandet sind. Und sobald man selbst Gruppenleiter wird, ist es noch schwieriger: Auf dieser Karrierestufe ist es für Forscherpaare kaum möglich, zwei gleich gute Jobs in einer Stadt zu finden.
STANDARD: Bei Forscherpaaren ist die Fernbeziehung die Normalität?
Obenauf: Ja, es kommt sehr oft vor. Oder man macht eben Kompromisse. Und hofft, dass man trotzdem seinen Weg macht. Mein Partner hat kürzlich eine Professur in Zürich angeboten bekommen und sich jetzt dafür entschieden, in Wien zu bleiben.
(Robert Czepel, 4.4.2016)
Anna Obenauf (32) hat an der Med-Uni Graz ihren PhD gemacht und war danach fünf Jahre am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York tätig. Nun leitet sie eine Gruppe am Wiener Institut für Molekulare Pathologie. Für ihre Forschungen erhielt sie 2015 den ASciNA Award des Wissenschaftsministeriums.